Reklame des Guten

Seit zwei Jahren sammeln wir sporadisch Bilder von Schildern im Odenwald und an der Bergstraße, die auf Hofläden oder Direktverkauf hinweisen. Viele dieser Schilder sind dilettantisch gestaltet, falsch geschrieben und potthässlich. Aber sie alle sind eins. Sie sind eine Einladung, regionale und saisonale Lebensmittel direkt vor Ort zu kaufen. Sie alle weisen auf die letzten Bastionen hin, die uns von der endgültigen Einvernahme des endlich Guten durch die industrielle Normgesellschaft trennen.

Smurf stoppt den Wagen. „Hast du eben das Hofladenschild gesehen?“, fragt er.
„Nö.“, antworte ich. Aber natürlich habe ich es gesehen, doch draußen ist es schweinekalt und hier habe ich eine Sitzheizung.
„Soll ich …?“, fragt er. Nein, er soll nicht.
Also grunze ich unmutig und wälze mich mit der Kamera bewaffnet aus dem Auto. Ich fotografiere dieses Hofladen-Schild wie immer im Querformat, prüfe die Belichtung und dann die Bildschärfe. Das Ganze dauert keine drei Minuten und spielt sich seit zwei Jahren immer so ab – auch bei strahlender Sonne im Mai. Der Mensch braucht Rituale.
Und zum Ritual gehört auch oft der misstrauische Blick eines Anwohners, der gerade den Gehweg mit dem Besen schrubbt oder die Spitzen seines Jägerzauns nachschärft. Man muss sich schließlich schützen gegen diese Schwachköpfe, die hier einfach so Schilder fotografieren. Ich meine, geht doch nicht.
Ich erinnere mich an schmutzige Schrumpelmöhren
Wieder im Auto, frage ich mich, wann mir eigentlich das erste Mal solche Schilder aufgefallen sind. Als Sohn eines Lebensmittelgroßhändlers hatten wir alles auf Lager. Immer. Außer Fleisch. Das war etwas Besonderes und das gab es nicht jeden Tag.
Schon als Kind war ich mit den Restaurant- und Wurstküchen meiner Heimatstadt vertraut, habe Schlachthöfe und Großmärkte kennengelernt oder meinen Vater begleitet, wenn der bei Bauern während der Erntezeit Obst und Gemüse gekauft hat. Da war so eine alte Bäuerin, die mir jedes Mal eine Mark gegeben hat, wenn ich meinem Vater beim Verladen von Kohlkisten geholfen habe. Aber Schilder …
Überhaupt war von Regionalität, Saisonalität oder gar Bio nie die Rede. Ein Rotkohl war ein Rotkohl. Und Bananen gab es von Dole und Chiquita. Die Welt schien in Ordnung. Doch dann tauchten merkwürdige Typen im selbstgestrickten Pulli auf dem Wochenmarkt auf und boten schmutzige Schrumpelmöhren an. Das muss so Ende der Siebziger oder Anfang der Achtziger gewesen sein.
Zuerst nahm niemand diese langhaarigen Zottelböcke für voll – außer vielleicht einige durchaus interessante Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts. „Du, weißt du, ich habe da einfach ein besseres Gefühl. Also irgendwie, ne.“ Scheiße, da konnte ich mir den Rotkohl von meinem Vater in die Haare schmieren.
Von nun an ging’s bergab
Irgendwie ist dieser Song von Hildegard Knef bezeichnend für das, was folgte. Doch gehen wir schrittweise vor.
Die „dreckigen Ökos“ – wie man sie durchaus nannte – setzen sich zum Erstaunen der Gegenseite durch. Denn das Unbehagen der Menschen bot ihnen einen fruchtbaren Boden, den die industrielle Landwirtschaft selbst bereitet hatte. Die Bio-Welle überrollte das Land und selbst mich.
Doch Lebensmittel-Industrie und Handel sind flexibel. Zuerst versuchten sie es argumentativ. Zum Beispiel ließen sie einige verrückte Wissenschaftler ausrechnen, dass massenhaft importierte Äpfel aus einem Land auf der anderen Seite unserer Welt ökologisch sinnvoller seien, als die Äpfel aus dem kleinen Garten vom Nachbarn. Hat aber keiner geglaubt.
Also adaptierten sie schlussendlich den Bio-Gedanken, gemäß des Leitsatzes: „Wenn du einen Gegner nicht besiegen kannst, mach ihn zu deinem Freund.“ Also brachten sie selbst entsprechende Produktlinien heraus und bewarben diese mit viel Aufwand. Eine dieser Linien hieß übrigens BioBio, was mich glauben ließ, ich sei im falschen FilmFilm.
Diese Schritte hätte die Industrie ohne die tatkräftige Unterstützung aus der Politik niemals gehen können. In einem Konzern arbeiten eben mehr Wähler als auf dem Acker in Fränkisch-Crumbach oder sonstwo.
Und da sind wir dann bei der Regionalität von Produkten gelandet, die heute in Supermärkten die entscheidende Rolle in der Selbstbeschreibung spielt, aber nicht unbedingt im Sortiment. Das Gute aus der Region preisen sie jetzt vollmundig an. Ha! Klar, Kassel liegt nicht direkt in Neuseeland, aber auch nicht gerade in Südhessen.
Wenn also alle Ideen und Grundsätze von der Industrie adaptiert und deformiert werden, wo findet man dann noch einen Ausweg? Ganz einfach – den findet ihr in euch.
Augen auf beim Eierkauf … und so

Man kann natürlich über die bösen Politiker und Manager schimpfen (und man sollte das des Öfteren auch tun), aber eigentlich beginnt alles damit, sich an die eigene Nase zu fassen, respektive dort zu kaufen, wo der Einfluss oben genannter recht klein ist – beim Direktvermarkter oder im Hofladen um die Ecke.
Erstaunlicherweise findet man in diesen Rückzugsgebieten alles Regionale oder Saisonale und meist in bester Qualität zu vernünftigen Preisen. Und wer wissen will, mit welcher Gülle der Landwirt sein Gemüse einreibt, der kann einfach fragen.
Also sucht nach den Schildern, auf denen der Plural von Kartoffel und Zwiebel ohne abschließendes „n“ auskommt, die Äpfel aber durchaus mal eins bekommen. Nach Schildern, die beste Eier hinter der Klappe anpreisen oder Wurst in Dosen nach Hausmacherart. Und dann …
… dann werde ich brutal aus meinen Gedanken gerissen. „Hast du eben das Hofladenschild gesehen?“
„Nö.“
Galerie der Schilder
















Die Bildauswahl stammt von Michael Frank und Thomas Hobein.
(Beim Schreiben u.a. gehört: „Up With People“ im Zero / Remix vom Lambchop)

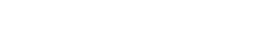
Herzlichen Dank für diesen ganz tollen Beitrag und vor allem für diese super Bilderkollektion, die mich immer wieder aufmuntert und erheitert! Der Favorit ist für mich ganz klar „Odenwälder Hausmacherspezialitäten Karl Bauer“ – wunderbare Ausführung & Gestaltung!
Alles Gute und beste Grüße!